
Zecken (v.a. Holzbock) können verschiedene Erreger übertragen und damit verschiedene Krankheiten verursachen. Die beiden wichtigsten sind die Borreliose (Lyme-Krankheit, verursacht durch das Bakterium Borrelia burgdorferi) und die durch ein Virus hervorgerufene Zecken-Meningoenzephalitis, auch Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) genannt.

Die Zecke Ixodes ricinus.
Foto: Richard Bartz, Licence Creative Commons
Bei der Borreliose werden Bakterien und bei der FSME Viren übertragen. Borreliose mit einem Antibiotikum behandelt werden kann, gibt es keine spezifische Behandlung für die FSME. Die Impfung gegen FSME ist daher die einzige wirksame Schutzmassnahme gegen diese Infektion.
Zecken, die das FSME-Virus tragen, halten sich in so genannten Naturherden auf. Diese kommen vorwiegend in der Nordostschweiz, aber auch in fast allen anderen Regionen der Schweiz vor. Bis zu 1% der Zecken in Naturherden tragen das FSME-Virus in sich.
Die Mehrzahl der Infektionen mit dem FSME-Virus verlaufen symptomlos. Andernfalls entwickeln sich einige Tage bis wenige Wochen (2 bis 28 Tage) nach dem Zeckenstich grippeähnliche Symptome wie Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Bei den meisten Betroffenen ist damit die Erkrankung nach einigen Tagen beendet. Sie sind anschliessend wahrscheinlich lebenslang gegen diese Krankheit immun.
Bei 5 bis 15% der erkrankten Personen kann es nach weiteren 4 bis 6 Tagen zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) kommen, die auch auf das Gehirn übergreifen kann (Meningoenzephalitis) und selten auch auf das Rückenmark (Meningoenzephalomyelitis). Die damit einhergehenden Symptome sind Nackensteifigkeit, Bewusstseinstrübung und Lähmungen. Restbeschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Schwindel können über Wochen bis Monate andauern, bilden sich jedoch in den meisten Fällen wieder zurück.
Bei schweren Verlaufsformen können Folgeschäden zurückbleiben. Bei ca. 1% der Erkrankten (meistens älteren Patienten) verläuft die Erkrankung tödlich. In der Regel erkranken Kleinkinder (unter 6 Jahren) seltener und ihr Krankheitverlauf ist weniger schwer als bei älteren Personen.
Weitere Informationen:
Infoportal übertragbare Krankheiten
Zeckenprävention mit dem Smartphone
Impfung gegen Zeckenenzephalitis (FSME)

Zu den allgemeinen Schutzmassnahmen gehören: gut abschliessende Kleidung, Repellentien, Meiden des Unterholzes, Absuchen von Kleidung und Körper nach Zecken nach Exposition, Zecken möglichst schnell entfernen, Desinfektion. Viele Zeckenstiche werden aber nicht oder zu spät bemerkt. Die Impfung ist daher die einzige Möglichkeit, sich zuverlässig wirksam zu schützen. Die Impfstoffe gegen Zecken-Meningoenzephalitis enthalten abgetötete Viren. Ihre Wirkung wird durch ein Aluminiumsalz unterstützt.
Die Impfung erfordert drei Impfdosen (0, 2-4 Wochen, 5-12 Monate). Auffrischimpfungen werden alle 10 Jahre empfohlen.
Impfempfehlung
Die Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird allen Einwohnern der Schweiz (mit Ausnahme des Tessins) empfohlen, die im Rahmen von Freizeitaktivitäten oder beruflich gegenüber Zecken exponiert sind (Aufenthalt in Wäldern, Waldrändern, Hecken, Büschen etc.). Die Impfung geht zu Lasten der obligatorischen Grundversicherung oder des Arbeitgebers, auch für die Einwohner des Tessins, die sich in Risikogebiete anderswo in der Schweiz begeben. Eine Impfung eübrigt sich für Personen, die kein Expositionsrisiko haben.
Bei Kleinkindern unter drei Jahren ist eine Impfung im Allgemeinen nicht notwendig, da schwere Erkrankungen in dieser Altersgruppe selten sind; sie ist aber ab 1 Jahr möglich, wirksam und sicher. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat im Jahr 2024 die untere Alterslimite von 6 auf 3 Jahre gesenkt, weil sehr selten schwerere Verläufe bei Kindern im Vorschulalter beobachtet wurden.
Es ist nie zu spät, eine oder mehrere Impfungen nachzuholen.
Schutzgrad der Impfung gegen Zeckenenzephalitis
Für die vollständige Grundimmunisierung sind drei Dosen notwendig. Die ersten beiden Dosen, die im Allgemeinen im Abstand von 2-4 Wochen verabreicht werden, bieten bereits einen wirksamen, aber zeitlich begrenzten Schutz. Die dritte Impfdosis kann bereits fünf Monate nach der zweiten Dosis gegeben werden und gewährleistet einen Schutz von über 95% für mindestens 10 Jahre. Falls das Risiko weiterhin besteht, wird eine Auffrischung alle zehn Jahre empfohlen, aber nicht öfter. Personen, welche diese 10-jährliche Auffrischdosis verpasst haben, können ihren Schutz jederzeit mit einer Impfdosis wiederherstellen. Auch sie sind dann wieder 10 Jahre lang geschützt.
Bekannte Nebenwirkungen der FSME-Impfstoffe
Die Impfung wird im Allgemeinen gut vertragen. Lokale Reaktionen (Rötung, kleine Schwellung, Schmerzen) an der Einstichstelle werden bei rund einem Drittel der Personen beobachtet. Diese Reaktionen verschwinden nach 1 bis 2 Tagen. Mögliche allgemeine Reaktionen sind (mit abnehmender Häufigkeit): Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Übelkeit und Gelenkschmerzen. Fieber wird selten beobachtet. Schwerere allergische (anaphylaktische) Reaktionen werden mit den neuen Impfstoffen sehr selten (1 bis 2 Reaktionen auf 1 Million Dosen) beobachtet. Schwere neurologische Nebenwirkungen sind sehr selten (1 auf 70’000 bis 1 auf Million Dosen).
Weitere Informationen:
Sicher und unkompliziert – Impfen direkt in der Apotheke




Etwa 15% der Bevölkerung tragen im Nasen-Rachen-Raum Neisseria meningitidis (Meningokokkenbakterien), ohne dabei krank zu werden. Wenn aber gewisse Stämme dieser Bakterien über die Schleimhaut ins Blut gelangen, kann es zu schweren Erkrankungen kommen. Es gibt fünf hauptsächlich für Infektionen verantwortliche Gruppen von Meningokokken (A, B, C, W und Y). Meningokokkenerkrankungen sind häufig mit Komplikationen verbunden. Die eitrige Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Blutvergiftung (Sepsis) zählen zu den gefürchtetsten Krankheitsformen. Durch die rasante Ausbreitung der Bakterien über die Blutbahn kann es rasch zu einem Schock und zum Versagen mehrerer Organe kommen.

4 Monate altes Baby mit einer Durchblutungsstörung der Hand aufgrund einer Meningokokkeninfektion.
Foto: Centers for Disease Control and Prevention
Die Sterblichkeit von Meningokokkenerkrankungen beträgt ungefähr 7%. Bei 20% der Fälle kommt es zu schweren Narbenbildungen, Verlust von Gliedmassen und zu bleibenden Schäden des Zentralnervensystems (Lähmungen, geistige Entwicklungsdefizite, Taubheit). Glücklicherweise sind diese schweren Erkrankungen relativ selten. Ihre Häufigkeit war in der Schweiz zwischen 2001 und 2020 deutlich ruckläufig. Jedes Jahr werden im Durchschnitt 48 schwere Meningokokken-Infektionen gezählt. Der Hauptanteil davon betrifft Säuglinge < 1 Jahr (5.1 Fälle / 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner), gefolgt von Jugendlichen zwischen 15-19 Jahren (1.8 Fälle / 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner) und Kleinkindern zwischen 1-4 Jahren (1 Fall / 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner). Zwischen 2011 und 2020 waren 40% dieser Fälle auf Meningokokken B und 23% auf Meningokokken W sowie je gut 18% auf Meningokokken C und Y zurückzuführen. Bei Säuglingen lag der Anteil an Meningokokken der Serogruppe B bei 76%, bei Kleinkindern bei 73%, während diese bei den Jugendlichen für 39% der Fälle verantwortlich waren.
Weitere Informationen:
Das folgende Dokument enthält Einzelheiten zur epidemiologischen Entwicklung der Meningokokken: PDF - Ergänzende Impfempfehlungen zum Schutz vor invasiven Meningokokken-Erkrankungen
Meldepflichtige Infektionskrankheiten → Meningokokkenerkrankung, invasiv
Impfungen gegen Meningokokken
Die Impfstoffe gegen Meningokokken sind inaktivierte Impfstoffe und enthalten Antigene eines oder mehrerer Meningokokenstämme. In der Schweiz sind zwei Vierfach – Impfstoffe gegen Meningokokken A, C, W und Y (Menveo® und Menquadfi®) sowie ein Impfstoff gegen Meningokokken B (Bexsero®) zugelassen.
Seit Januar 2024 gilt folgende Impfempfehlung gegen Meningokokken:
Gegen Meningokokken ACWY
1) Säuglinge zwischen 12 und 18 Monaten: 1 Dosis MenQuadfi® oder 2 Dosen Menveo® im Abstand von 2 Monaten. Nachholimpfung bis zum 5. Geburtstag. Ab 24 Monaten: 1 Dosis, unabhängig vom Impfstoff;
2) Jugendliche zwischen 11 – 15 Jahren: 1 Dosis MenQuadfi® oder Menveo®. Nachholimpfung bis zum 20. Geburtstag.
Gegen Meningokokken B
1) Säuglinge mit 3 (2+1) Dosen Bexsero® : 2 Dosen im ersten Lebensjahr (Mindestabstand 2 Monate); 3. Dosis im zweiten Lebensjahr (mindestens 6 Monate nach der 2. Dosis). Nachholimpfung bis zum 5. Geburtstag: Impfbeginn 12 – 23 Monate mit 3 Dosen, 3. Dosis mindestens 12 Monate nach der 2. Dosis / Impfbeginn ab 24 Monaten: 2 Dosen im Abstand von mindestens einem Monat.
2) Jugendliche zwischen 11 – 15 Jahren: 2 Dosen Bexsero® im Abstand von mindestens 1 Monat. Nachholimpfung bis zum 20. Geburtstag.

Quelle: BAG-Bulletin 3 vom 15. Januar 2024
Personen mit einem erhöhten Risiko für Meningokokkeninfektionen
Personen mit bestimmten Erkrankungen haben ein höheres Risiko, an einer Meningokokkeninfektion zu erkranken. Dazu gehören Personen mit:
- bestimmten Blutkrankheiten (Defizite der Terminalfaktoren oder der Faktoren des alternativen Komplementwegs, Koagulopathien in Verbindung mit einem homozygoten Protein-S- und -C-Defizit)
- Funktionsstörungen der Milz (funktionelle oder anatomische Asplenie) oder immunologische Störungen, die eine reduzierte oder fehlende Immunantwort auf Polysaccharide zur Folge haben.
Sie sollen so rasch als möglich nach Diagnosestellung gegen Meningokokken A,C,W,Y sowie gegen Meningokokken B geimpft werden (altersabhängige Impfschemata mit initial 3 bzw. 2 Impfdosen). Zusätzlich ist eine Auffrischimpfung alle 5 Jahre nötig.
Personen mit einem erhöhten Kontakt- und/oder Übertragungsrisiko
Personen in bestimmten Situationen haben ein höheres Risiko, sich mit Meningokokken anzustecken. Dazu gehören folgende Personengruppen:
- Beschäftigte in mikrobiologischen Labors, die bei ihrer Arbeit mit Meningokokken-Suspensionen in Kontakt kommen könnten (Serogruppen A, C, W, Y und B).
- Reisende mit Aufenthalten von mehr als einem Monat in einem Endemiegebiet oder auch bei kürzerem Aufenthalt in einem Epidemiegebiet (Serogruppen A, C, W und Y).
- Rekruten und Rekrutinnen, die in den letzten fünf Jahren nicht geimpft wurden (Serogruppen A, C, W, Y und B).
- Enge Kontaktpersonen von Patientinnen und Patienten, bei denen eine Infektion mit Meningokokken wahrscheinlich oder sicher ist (Serogruppen A, C, W, Y oder B beim Indexfall).
- Nicht geimpfte Kinder und deren Betreuenden in einer Krippe, nicht geimpften SchülerInnen und deren Lehrpersonen in einer Klasse, wenn zwei sichere oder wahrscheinliche Fälle innerhalb von 12 Wochen aufgetreten sind (Serogruppen A, C, W, Y und B).
Diese Personen sollen gegen Meningokokken A,C,W,Y und in gewissen Situationen auch gegen Meningokokken B geimpft werden.

Quelle: BAG-Bulletin 7 vom 12. Februar 2024 (Addendum)
Die Kosten für die Meningokokkenimpfungen werden gemäss den aktuell gültigen Empfehlungen von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) für die Altersgruppen übernommen, für welche eine entsprechende Zulassung vorliegt (Bexsero®: 2 Monate bis 24 Jahre, Menveo®: 2 Monate bis 65 Jahre; Menquadfi®: ab 12 Monaten). Ausserhalb dieser Altersgruppen gelten die Impfungen als "off-label" und werden daher nicht von der OKP übernommen.
Es ist nie zu spät, eine oder mehrere Impfungen nachzuholen. Zögern Sie nicht, Ihren Impfausweis von einer Fachperson überprüfen zu lassen, die Sie beraten kann.
Medizinischer Rat für Reisende
Schutzgrad der Impfung gegen Meningokokken
Die Wirksamkeit der quadrivalenten Impfstoffe (A, C, W, Y) beträgt 83% bis 98% bei Kindern zwischen 1 und 4 Jahren und 93% bis 96% bei Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren.
Die Wirksamkeit des Meningokokken-B-Impfstoffs (Bexsero®) liegt - je nach Impfschema (Alter bei der ersten Impfung, Anzahl der Dosen und Dauer der Beobachtung) - zwischen 60% und 94%, wie in mehreren europäischen Ländern durchgeführte Studien belegen.

Bekannte Nebenwirkungen des Meningokokken-Impfstoffs
Konjugat-Impfstoffe (Vierfachimpfstoffe gegen Meningokokken A,C,W,Y) wurden speziell für Säuglinge entwickelt und sind sicher und insgesamt gut verträglich. Als Nebenwirkungen werden sowohl leichtes Fieber, Reizbarkeit, Schläfrigkeit oder Appetitlosigkeit als auch lokale Reaktionen an der Einstichstelle wie Schwellung, Schmerzen und Rötung (bei 1 bis 4 von 10 Kindern) beschrieben. Fieber kann bei gewissen Kindern einen Fieberkrampf auslösen. Jugendliche klagen häufig über Muskel- oder Kopfschmerzen nach der Meningokokkenimpfung. Diese unerwünschten Impferscheinungen sind zwar unangenehm, aber ungefährlich und vorübergehend, und werden um ein Vielfaches vom Nutzen der Meningokokkenimpfung übertroffen. Es wurden auch andere Probleme nach den Impfungen gemeldet. Sie sind ausserordentlich selten (1 auf 100'000 bis 1 auf eine Million Impfungen). Entsprechend ist es schwierig zu beurteilen, ob die Impfung die Ursache dieser Probleme ist oder nicht.
Beim Meningokokken B-Impfstoff (Bexsero®) sind leichte bis mittelschwere Nebenwirkungen beschrieben. Diese sind im Allgemeinen von kurzer Dauer und betreffen mehrheitlich Säuglinge. Insbesondere wenn Bexsero® gleichzeitig mit anderen im Säuglingsalter empfohlenen Impfstoffen verabreicht wird, kommt es häufig (>10%) zu Fieber, ausgeprägten lokalen Reaktionen wie Schwellung sowie zu Erbrechen. Die vorbeugende Einnahme von Paracetamol senkt die Häufigkeit von Fieber bei Säuglingen deutlich. Auch bei Jugendlichen und Erwachsenen kann es nach der Impfung zu Fieber, Unwohlsein oder lokalen Reaktionen an der Einstichstelle kommen.
Weitere Informationen:




Der Mumps wird durch ein Virus verursacht, das die Speicheldrüsen anschwellen lässt, was den Anschein von «Hamsterbacken» geben kann. Die Erkrankung beginnt in der Regel mit Fieber und oft auch mit Kopfschmerzen, bevor innert etwa 48 Stunden die meist beidseitige Speicheldrüsenschwellung auftritt. Sie betrifft in der Regel die Ohrspeicheldrüsen. Die Krankheit verläuft meist gutartig und die Symptome verschwinden innerhalb einer Woche wieder. Mögliche Komplikationen sind:
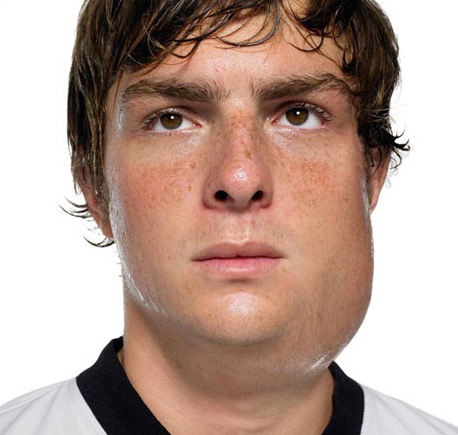
Photo: Centers for Disease Control and Prevention
- Hirnhautentzündung (Meningitis) bei etwa 1-10% der Betroffenen
- eine sehr schmerzhafte Entzündung der Hoden (Orchitis). Sie kommt hautsächlich nach der Pubertät vor und betrifft 15-30% aller infizierten Männer. Sie führt oft zu einer bleibenden Schädigung des betroffenen Hodens. Weil sie mehrheitlich einseitig auftritt, ist bleibende Sterilität selten
- selten Taubheit, meist einseitig und in der Regel bleibend.
Trotz aller Fortschritte, die Dank der Impfungen gemacht werden konnten, ist in der Schweiz das Risiko für Mumps-Epidemien immer noch vorhanden.
Weitere Informationen:
Sentinella - Aktuelle Meldungen
Impfung gegen Mumps
Gegen Mumps wird ein Lebendimpfstoff verwendet. Er löst eine Immunantwort aus, ohne dass die Krankheit zum Ausbruch kommt. Die Impfung gegen Mumps wird mit der Impfung gegen Masern und Röteln kombiniert (MMR) oder auch zusätzlich mit Windpocken (MMR-V-Impfstoff). Beide Impfstoffe enthalten kein Aluminium.
Für einen vermutlich lebenslangen Schutz sind zwei Impfdosen und eine hohe Impfrate in der Bevölkerung erforderlich.
Seit Januar 2023 wird die Impfung gegen Mumps, Masern, Röteln und Windpocken für Kinder im Alter von 9 und 12 Monaten empfohlen (bei erhöhtem Risiko ab dem 6. Monat). Sie wird ebenso nicht geimpften älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nach 1963 geboren wurden, empfohlen.
Empfehlungen für Personen mit einem erhöhten Kontakt- und/oder Übertragungsrisiko
Bei Personen, die Kontakt zu kleinen Kindern haben (Krippen, Schulen), und bei Beschäftigten des Gesundheitswesens besteht ein besonders hohes Risiko, dass sie mit Mumps in Berührung kommen oder die Krankheit übertragen. Sie sollten deshalb sicherstellen, dass sie zwei wirksame Impfdosen gegen Mumps erhalten haben.
Schutzgrad der Impfung gegen Mumps
Die kombinierte Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR) ist sehr wirksam. Nach zwei Impfdosen sind ca. 85% der Personen gegen Mumps geschützt. Achtung: Eine Einzeldosis schützt bestenfalls nur zu etwa 60%.
Bei den meisten vollständig geimpften Personen hält der Schutz das ganze Leben an. Auch wenn eine Person bereits Röteln oder Masern gehabt hat, kann sie sich mit dem MMR-Impfstoff impfen lassen. Ihre Antikörper deaktivieren den oder die unnötigen Bestandteil(e) des Impfstoffs sofort. Nur die benötigten Komponenten stimulieren die Immunabwehr, um den gewünschten Schutz zu erreichen.
Bekannte Nebenwirkungen des Mumps-Impfstoffs
Die MMR-(V) Impfung wurde im Hinblick auf die bestmögliche Wirksamkeit und Verträglichkeit entwickelt. Nach der Impfung gibt es selten eine lokale Reaktion an der Einstichstelle.
Ungefähr eines von zehn Kindern reagiert mit Fieber. Manchmal (in 2 bis 4 von 100 Fällen) zeigen sich ein leichter Hautausschlag oder eine Schwellung der Speicheldrüsen. Falls diese Reaktionen auftreten, dann meist sieben bis zehn Tage nach der Impfung.
Sehr hohes Fieber kann bei Kleinkindern einen Fieberkrampf zur Folge haben (bei 1 von 3000 Kindern).
Bei einem von 30'000 geimpften Kindern hat die MMR-(V) Impfung eine vorübergehende Senkung der Blutplättchen zur Folge, was wiederum mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden ist (meist Hautblutungen); eine Komplikation, die nach der Impfung viel seltener auftritt als nach echten Masern oder Röteln.
Schwere Nebenwirkungen sind extrem selten (weniger als 1 pro Million). Andere Ereignisse nach diesen Impfungen wurden gemeldet, sind aber so selten (weniger als 1 auf 100'000 bis 1 Million), dass es sehr schwierig ist herauszufinden, ob die Impfung die Ursache ist oder nicht. Die MMR-(V) Impfung überlastet das Abwehrsystem nicht, sie erhöht auch nicht das Risiko für andere chronische Krankheiten (Allergien, Autismus, entzündliche oder Autoimmunkrankheiten).

Weitere Informationen:



